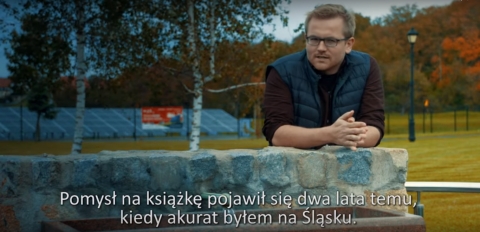Ich wurde von der Konrad Adenauer Stiftung nach Wiesbaden eingeladen, um dort in einem Vortrag eine Synthese zu finden zwischen den heutigen Erwartungen der Deutschen, Polen und schließlich der deutschen Minderheit in Polen an Europa. Ich gebe zu, dass es ein halsbrecherisches Thema ist, was dazu geführt hat, dass ich keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen konnte. Eigentlich musste ich mich auf die Unterschiede der Erwartungen konzentrieren.
Als ich im Vortrag dann uns, die Deutschen im heutigen Schlesien, Pommern, Ermland und Masuren, thematisiert habe, musste ich zum wiederholten Mal erklären, warum nach meiner Meinung alle im Zuge der Grenzverschiebungen nach dem Krieg und der Vertreibungen ihre Heimat verloren haben. Der Unterschied besteht nämlich nur darin, dass die einen sie im territorialen Sinn verloren haben, wir dagegen, die geographisch weiterhin in der Heimat leben, sie kulturell verloren haben. Und im Grunde weiß man nicht, welcher Heimatverlust nun der schmerzhafteste ist.
Meine mehrtägige Reise über Schlesien und Tschechien nach Bayreuth zur langersehnten Aufführung von Wagners berühmtem "Tannhäuser" zeigte mir wieder einmal schmerzhaft, wie sehr wir, die Deutschen in Polen, von unserer Kultur abgeschnitten wurden. Es ist ja doch nicht nur die Sprache, sondern die gesamte Literatur, Geschichte, Kunst, die wir seit Kindertagen kennenlernen und mit jedem Schuljahr vertiefen sollten. Dagegen erfuhren wir auf unserem Bildungsweg fast nur fremde Muster, eine Geschichte, die mit unserer Heimat nichts zu tun hat. Und wenn wir nun historische Orte besuchen, ertappen wir uns dabei, dass uns die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges völlig fremd ist und dass wir nicht wissen, dass jeder böhmische König Kurfürst gewesen ist, der den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mitgewählt hatte. Kinder in Schlesien lernen dagegen über den Aufstand Chmielnickis in der Ukraine oder die Schwedische Flut, die nicht einmal ansatzweise an Schlesien heran kam.
Wenn einige von uns, die sich ihrer Herkunft bewusst sind, im Erwachsenenalter die Mühen auf sich nehmen, ihre Kultur kennenzulernen, müssen sie große Lücken schließen. Es ist aber gut, wenn wir diese Ungerechtigkeit überhaupt verstehen, denn das ist die Bedingung für die Mühen um die eigene Identität. In diesem Zusammenhang freute mich ein Kommentar unter meinem Facebook-Eintrag, dass das Leben nicht ausreicht, um die Tiefe des eigenen Kulturerbes zu ergründen. Der Kommentator schrieb, das sei geschehen, weil uns die Jahre zwischen 1945 und 1989 genommen wurden. Doch auch nach der politischen Wende konnte man diese Lücken nur durch eigene Initiative und viel Kraft überwinden. Unsere Identität bleibt wirklich weiterhin in unseren Händen und nicht in den schulischen Lehrprogrammen, die ihr leider nur wenig dienen.