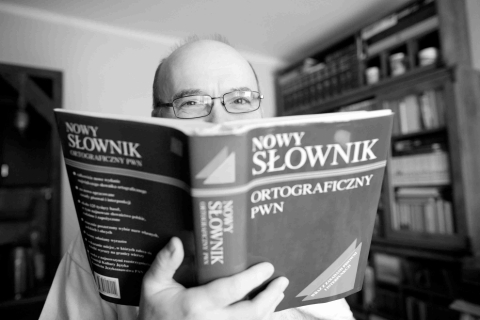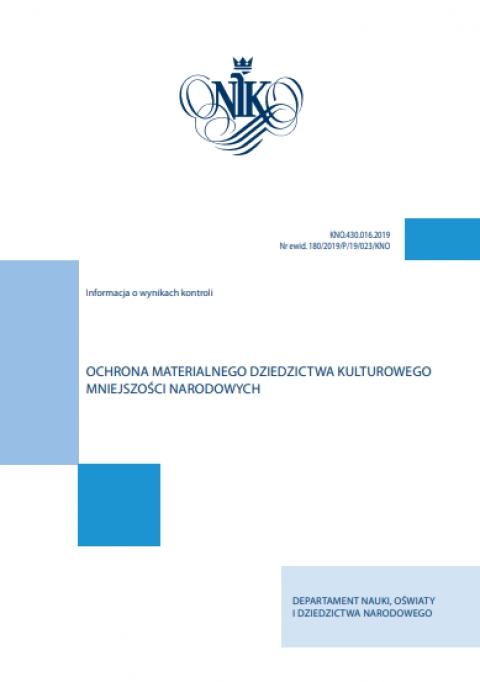Am vergangenen Freitag fand im Sitz des VdG in Oppeln Preisverleihungszeremonie statt, bei der an die besten Musiker der Deutschen Minderheit, die den Rekord des Interesses auf unseren Seiten brachen, Statuetten übergeben wurden. Fans einzelner Darsteller schickten in die Endrunde Dutzende, und einige sogar hundert Coupons.
Viele beschwerten sich, dass unsere Zeitung während des Wettbewerbs im Internet fehlte, es hat sich aber gelohnt. Denn so lernten wir die geschätzten, die populärsten und vielleicht sogar die beliebtesten Künstler der deutschen Minderheit kennen, denn auf vielen Coupons wurden oft Herzen gemalt, es gab auch Reime und freundliche Worte wie: "Wir lieben dich", "Immer mit dir", "Du bist der Beste" etc. Schließlich stellte sich in einer breiten Gruppe von Solisten, Duetten, Bands und Orchestern der deutschen Minderheit heraus, dass Karolina Trela unter den Solisten triumphierte, Proskauer Echo sich als Bestes in der Rivalität der Duetten erwies und Heimatklang der absolute Meister unter den Chören waren.
Wettbewerb wie ein Trampolin
Der Triumph einer extrem talentierten, jungen und wie sich auch herausstellte – einer beliebten Solistin Karolina Trela ist nicht überraschend. Ihr Fanklub ist nicht nur sehr zahlreich, sondern auch eingespielt, was die Sängerin aus Annengrund unschlagbar macht, obwohl sie hervorragende Konkurrenz aus den hintersten Weiten Oberschlesiens und sogar aus München in Person eines großen Schlagerstars Toby hatte. In dieser Ausgabe des Wettbewerbs konnte niemand Karolina Trela schlagen, aber wie konnte dies geschehen, wenn alle paar Tage 460 bis sogar 800 Coupons an die Adresse der Redaktion geschickt wurden! "Was passiert ist, ist wunderbar, ich habe davon geträumt! Ich bin stolz, genauso stolz auf mich sind meine Fans, meine Familie, mein Sohn. Vielen Dank! Das ist erstaunlich. Zumal ich mit fantastischen Künstlern im Wettbewerb stand!“, sagte Karolina Trela und fügte hinzu: "Triumph in diesem Wettbewerb ist für mich ein »Sprungbrett«, um wieder erfolgreich zu sein. Dank des Gewinns habe ich die Möglichkeit, mein erstes Album aufzunehmen!"

Unvergänglicher Ruhm
In ähnlicher Weise können wir alles zusammenfassen, was um das berühmteste Duo der Künstler der deutschen Minderheit – Proskauer Echo, zusammengestellt von Claudia und Henryk Lakwa – passiert ist. Proskauer Echo gewann definitiv den Wettbewerb um den Titel des besten Duos, was nicht nur die große Popularität dieser Band beweist, sondern auch ihren anhaltenden Ruhm. Es ist auch eine Herausforderung für sie, denn anscheinend kommen immer noch Fans von Künstlern aus Proskau an und warten auf neue Alben, Hits und Musikvideos: "Allen Fans, die so gierig Stimmen an das Proskauer Echo geschickt haben und Hunderte von Coupons geschickt haben, dank denen wir mehr als 45.000 Stimmen gesammelt haben, möchten wir vom ganzen Herzen sagen: Vielen Dank", sagte Henryk Lawa.

Der Heimatklang aus Klodnitz belegte den ersten Platz in der Klassifizierung der Chöre, die in ihrer Kategorie alle Illusionen der Konkurrenz beraubten und bewiesen, dass sie nicht nur schön singen, sondern auch wissen, wie sie sich um ihr Image und damit um die Popularität kümmern können. Man kann sagen: Profis in jeder Hinsicht...

Text: Krzysztof Świerc, Wochenblatt.pl
Fotos: Marie Baumgarten